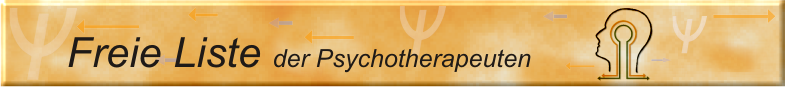Die unzureichende Gewichtung eines ethischen Aspekts der psychotherapeutischen Versorgung gefährdet die Arbeit der Niedergelassenen.
Rolf Wachendorf & Jan Glasenapp
die untere Fassung wurde im Ärzteblatt April 2021 veröffentlicht. Die Langfassung mit den Daten der KVBW ist hier herunterladen.
1. Versorgungsverantwortung
In §3 Abs. 2 der Musterberufsordnung der Psychotherapeut*innen (PT) werden die vier ethischen Grundprinzipien von Beauchamp und Childress aufgegriffen: a) die Autonomie und Selbstbestimmung, b) die Schadensvermeidung, c) die Fürsorge und d) die soziale Gerechtigkeit. Die aktuelle Diskussion um Versorgungsfragen beschränkt sich häufig auf die Forderung nach mehr Ressourcen in Form von mehr PT und den Wegfall von Zulassungsbeschränkungen. Dabei vermissen wir die inhaltliche Auseinandersetzung unserer Berufsgruppe mit sozialer Gerechtigkeit als Ausdruck von Versorgungsverantwortung.
Soziale Gerechtigkeit und Versorgungsverantwortung beinhalten Priorisierung, Begrenzung und Nachhaltigkeit. Priorisierung bedeutet, qualitative Behandlungsentscheidungen einerseits von der Schwere und andererseits von der Aktualität psychischer Erkrankung abhängig zu machen. Begrenzung bedeutet, quantitative Behandlungsentscheidungen von der Schwere der Erkrankung und der Prognose abhängig zu machen. Nachhaltigkeit bedeutet, Behandlungsentscheidungen in einen langfristigen Kontext zu sehen.
Sozialraumorientierung. Mit der Niederlassung geht die Verpflichtung zur Versorgung der Versicherten eines Sozialraums einher. Können wir Niedergelassene von uns behaupten, dass die Entscheidung zur Behandlung von Patient*innen (PAT) gerecht ist, dass Menschen mit dem gleichem psychischem Leidensdruck in unserem Sozialraum die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben? Wir müssen diese Frage leider stellen.
Das Selbstverständnis vieler PT und ihr Mitgefühl zur Fürsorge für ihre PAT scheint eine notwendige Gewichtung des Prinzips der sozialen Gerechtigkeit zu behindern, wenn die Fürsorge für Einzelne die Versorgung anderer schwerer Erkrankter einschränkt. Wir wünschen einen angemessenen Raum in der fachlichen und berufspolitischen Diskussion über diese Frage. Je mehr wir uns als Berufsgruppe dieser Diskussion verweigern, umso mehr laufen wir Gefahr, dass andere den Diskurs bestimmen werden, z.B. der Gesetzgeber, der dies bereits in Form ständiger Ausweitung von bürokratischen Anforderungen tut. Wir brauchen eine im professionellen Selbstverständnis verortete Versorgungsverantwortung, die dem Prinzip der Gerechtigkeit genügt.
Mehr Ressourcen bedeuten nicht bessere Versorgung. Wenn trotz umfangreicher Maßnahmen der Vergangenheit wie der Reform der Bedarfsplanungsrichtlinie sowie der Ressourcenausweitung durch die massive Zunahme an Zulassungen mit halbem Versorgungsauftrag weiterhin Versorgungsdefizite bestehen, dann macht sich die Berufsgruppe gegenüber anderen Akteuren unglaubwürdig. Wir wünschen uns daher eine intensive Diskussion über (un-)gerechte Verwendung der vorhandenen Ressourcen.
2. Wie wird soziale Gerechtigkeit in der Versorgungsverantwortung gegenwärtig umgesetzt? Beobachtungen von Rolf Wachendorf
Die vorgestellten Auswertungen beruhen auf landesweiten Abrechnungsdaten und Daten der Terminservicestelle (TSS) der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Diese Daten wurden erhoben, um rechtzeitig Versorgungsentwicklungen festzustellen, welche für die künftige Sicherstellung und speziell für die langfristige Existenzsicherung der Niedergelassenen maßgeblich werden könnten. Alle berichteten Daten fanden sich über Jahre hinweg in vergleichbarer Weise.
Versorgungsauftrag und Versorgungsrealität. Trotz massiver Zunahme der Praxen bestehen laut BPtK Wartezeiten. Ein Grund könnte sein, dass weniger als die Hälfte aller Niedergelassenen den gesetzlichen Mindestversorgungsauftrag für ihre Zulassung erfüllen. Gleichzeitig erschwert die Fragmentierung der Versorgung durch Praxen mit halbem Versorgungsauftrag die Kooperation mit ärztlichen Mitbehandler*innen.
Kein Abbau von Zugangsbarrieren. Die Sprechstunde wurde eingeführt, um zeitnah Behandlungsindikationen feststellen und Beratungsbedarfe von Krankenbehandlung zu trennen. Doch nur 50%-57% der Praxen mit vollem und 65%-70% mit halben Versorgungsauftrag erbringen die geforderte Sprechstundenmenge. Seit Einführung der Sprechstunde zeigt sich keine Fallzahlerhöhung pro Kopf, die einzelnen PT sehen also nicht mehr PAT. Die Flexibilisierung des Angebotes und ein niederschwelliger Zugang zur Psychotherapie finden demnach nicht statt.
Versorgungsdichte. Die TSS wurde zur Reduzierung von Wartezeiten eingeführt. Dortige Anmeldungen sind ein aussagekräftiger Indikator für Wartezeiten bei dringlicher Psychotherapie bzw. für ungedeckten Bedarf. Termine zur Sprechstunde und Akutbehandlung werden von der TSS vor allem in Regionen mit hoher PT-Dichte vermittelt. Daraus lasst sich ableiten, dass lange Wartezeiten und dringliche Akutbehandlungen weniger im ländlichen Raum bestehen, sondern vielmehr in bedarfsplanerisch hochversorgten Gebieten. Je höher die PT-Dichte in einer Region ist, umso höher war die Nachfrage nach Terminvermittlung durch die TSS. In Regionen mit geringer Dichte war kein Versorgungsstau erkennbar. Alle angefragten Termine wurden vermittelt. Je höher die Dichte, je höher die abgerechnete Morbidität im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl. Dies deutet auf eine Absenkung der Krankheitsdefinition in bedarfsplanerisch überversorgten Gebieten hin und damit auf eine angebotsinduzierte Nachfrage.
Gruppentherapie. 86% der PT mit Abrechnungsgenehmigung für Gruppentherapie erbringen diese nicht. Damit wird ein wichtiger Baustein zur Verbesserung der Versorgung nicht hinreichend genutzt.
Frequenz und Dauer von Psychotherapie. Die Wirksamkeit einzelner Therapiesitzungen nimmt mit zunehmender Behandlungsdauer ab. Nach den ersten Therapieerfolgen ist somit eine niederfrequente Behandlung angemessen.
Interpretation. Die beschriebenen Fehlentwicklungen zeigen Versorgungsdefizite als Folge der Art und Weise, wie Psychotherapie durchgeführt wird. Diese werden die Existenz von PT nachhaltig beeinträchtigen:
Ohne hinreichende Nutzung der Sprechstunde findet keine adäquate Steuerung der Versorgung statt. Es fehlt an Prozessen der Priorisierung z.B. in der Versorgung von psychisch schwer Erkrankten.
In Regionen, in denen ein PT auf 800-900 Einwohner kommt, wäre rechnerisch in 10 Jahren die gesamte Bevölkerung psychotherapeutische behandelt. Eine nachhaltige Existenz der Niedergelassenen kann nur gesichert werden, wenn einzelne PAT wiederholt behandelt werden oder es zu einer Absenkung des Krankheitskriteriums kommt. Wenn in solchen Regionen schwer psychisch kranke PAT lange warten müssen, verliert die Berufsgruppe an Glaubwürdigkeit.
3. Wie wird soziale Gerechtigkeit in der Versorgungsverantwortung gegenwärtig umgesetzt? Beobachtungen von Jan Glasenapp aus der Begutachtung von VT-Anträgen
Diagnosestellung. Häufig wird die Diagnosestellung nicht durch standardisierte Verfahren abgesichert. Daher kann die Schwere der Erkrankung unterschätzt werden, was sich in eher milden oder unklaren Diagnosen (z.B. F41.2) widerspiegelt. Sehr häufig werden Langzeittherapien bei F32 oder F33 gestellt, andere Diagnosen bleiben unberücksichtigt (z.B. F42, F45 etc.).
Diagnose und Behandlungsumfang. Der beantragte Umfang ist angesichts der gestellten Diagnose manchmal unangemessen, beispielsweise wenn bei F32.0 oder F43.2 60 Einheiten geplant werden.
Überschreitung des Höchstkontingents. Mit der Begründung „weiterer Stabilisierung“ entsteht zunehmend der Eindruck, dass die Behandlung mehr zu einer Lebensbegleitung in schwierigen Zeiten geworden ist, als der Behandlung von Krankheiten dient. So wird oftmals nicht deutlich, wie eine nachhaltige Verselbständigung der PAT erreicht werden soll, oder wie eine integrierte Behandlung mit anderen Fachgruppen erfolgen kann.
Vorbehandlungen. Mittlerweile überwiegt die Zahl der gutachtenpflichtigen Anträge für PAT, die nicht ihre erste Psychotherapie machen. Dabei überrascht es, wie wenig in den Berichten auf die Vorbehandlungen eingegangen wird und letztere zur Prognose kaum reflektiert wird.
Prognoseeinschätzung. Vereinzelt werden Gründe, die einer günstigen Prognose entgegen stehen, wenig reflektiert. So fehlt oftmals eine Suchtanamnese bei Subszanzmißbrauch. Oder es werden PAT behandelt, die sich in laufenden Rentenantragsverfahren befinden, ohne dass die die Störung aufrechterhaltenden Bedingungen reflektiert werden.
Rezidivprophylaxe. Oft fehlen Angaben zur Rezidivprophylaxe oder es wird ohne Begründung angegeben, dass diese noch nicht absehbar sei – auch bei rezidivierenden Störungen und Vorbehandlungen wo diese. insbesondere von schwer und chronisch psychisch Kranken sinnvoll ist.
Patienten mit Intelligenzminderung und anderer Gruppen sind leider immer noch die absolute Ausnahme.
Interpretation. In Gesprächen zeigt sich häufig, dass die Psychotherapie-Richtlinie, zumindest in der aktuellen Version, nicht bekannt ist. Auch wenn die meisten Anträge Ausdruck einer fundierten und engagierten Arbeit sind, zeigen sich Probleme, die Rückschlüsse auf grundsätzliche Defizite der Versorgung zulassen. Zusammenfassend ist unzureichend: die Absicherung der Diagnose, die Berücksichtigung der Vorgeschichte mit den erfolgten Behandlungen, eine kritische Reflexion der Prognose und des angemessenen Behandlungsumfangs sowie eine Berücksichtigung der Rezidivprophylaxe und damit der Planung der Behandlung in die Zukunft.
4. Was ist zu tun? Ausblick
Klare Trennung von Sozialarbeit, Beratung und Krankenbehandlung. Wenn Lebensbegleitung einzelner dazu führt, dass die Behandlung von Krankheiten anderer verhindert wird, dann stimmt die Gewichtung der sozialen Gerechtigkeit nicht mehr.
Qualitätssicherung von Behandlungsentscheidungen zu Priorisierung und Begrenzung in Form von Intervision sollte standardisierter Teil der Behandlungsdokumentation werden. Ab einem zu definierenden Behandlungsumfang sollte ein Zweitmeinungsverfahren obligat werden, in dem das bisherige Gutachtenverfahren zukünftig aufgeht.
Standardisierte Diagnostik wird obligat, um die Vergleichbarkeit des psychischen Leidens innerhalb des Sozialraums und zwischen verschiedenen Sozialräumen zu sichern. Damit kann in Regionen mit hoher PT-Dichte die Absenkung des Krankheitsbegriffs verhindert werden.
Sprechstunde zur Priorisierung nutzen, um die Patienten zu begrenzen, die keine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung oder eine ungünstige Prognose haben.
Die Behandlungs-Vergangenheit systematisch erfassen, indem Befundberichte erstellt und bei Bedarf weitergegeben werden. Nur so kann diese in der Prognose reflektiert werden.
Die Behandlungs-Zukunft systematisch unter Einbezug niederfrequenter Rezidivprophylaxe und Intervallbehandlung planen. „Nach der Psychotherapie ist vor der Psychotherapie“ wird für zunehmend viele Menschen zur Realität. Bei gegebener Indikation, z.B. rezidivierenden Erkrankungen, ist die Rezidivprophylaxe zu erweitern und zum Standard der Versorgung zu werden.
Kooperative und vernetzte Praxisstrukturen mit einer gemeinsamen Erreichbarkeit (Telefonnummer) und gemeinsamer Anmeldung (Website). Die Praxis-Netze sollten in der Lage sein, Gruppentherapie als Standardbehandlung anzubieten.
Berufsrechtliche Berücksichtigung von Versorgungsverantwortung, indem die Kammern die Selbstregulation unserer Berufsgruppe und ihre Verantwortungsübernahme, z.B. über KreisPTschaften, unterstützen. Dazu gehört die Beendigung der Forderung nach erweiterter Bedarfsplanung. Erst wenn wir als Berufsgruppe unsere Hausaufgaben gemacht haben, wäre zu prüfen, ob und wo Neuzulassungen notwendig sind. Dem Bedarf der Bevölkerung nach Beratung und Begleitung in Belastungssituationen muss durch Forderung nach Ausbau der Beratungsstellen begegnet werden – nicht nach Forderungen zum Ausbau der Krankenbehandlung.
Sozialrechtliche Berücksichtigung von Versorgungsverantwortung. Über die Umsetzung der Richtlinienbestimmungen hinaus sollte der Behandlungsbedarf des Kranken den Behandlungsumfang bestimmen, nicht das angewendete Verfahren.
Über Selektivverträge sollte der Aufbau versorgungsorientierter Strukturen erfolgen statt einer kleinräumigen, bundesweiten Bedarfsplanung. Kassen können so regionale Besonderheiten berücksichtigen.
Zum Abschluss. Stellen Sie kritisch Fragen an Verbands- und Kammervertreter*innen und bringen Sie Ihre Ideen ein, damit Handlungsdruck entsteht und die Versorgungsverantwortung unserer Berufsgruppe in den Fokus gestellt wird. Vielen Dank!
Die wieder gegebenen Meinungsäußerungen und/oder Tatsachenbehauptungen liegen in der alleinigen Verantwortung der Autoren.